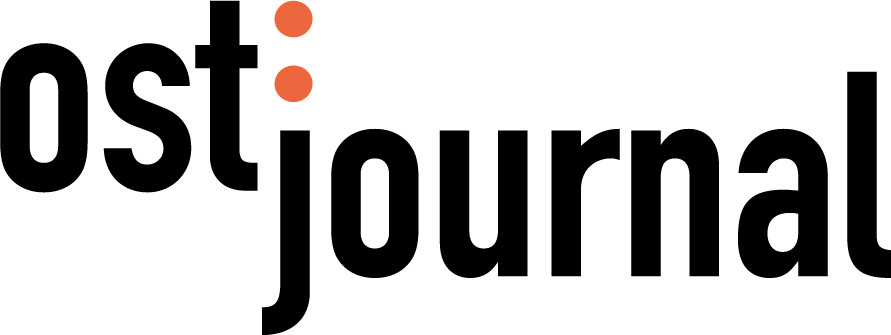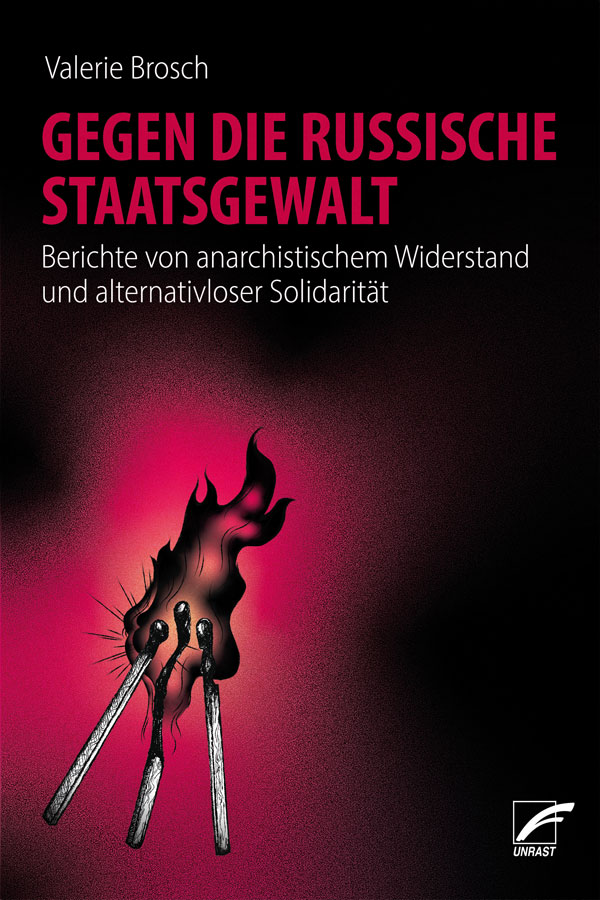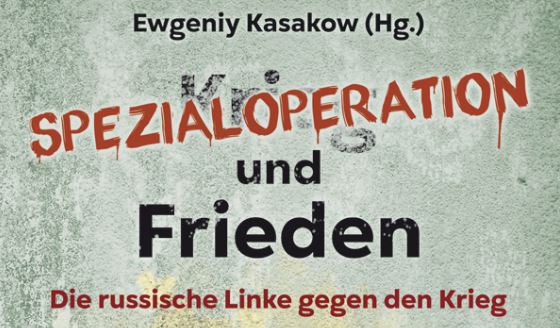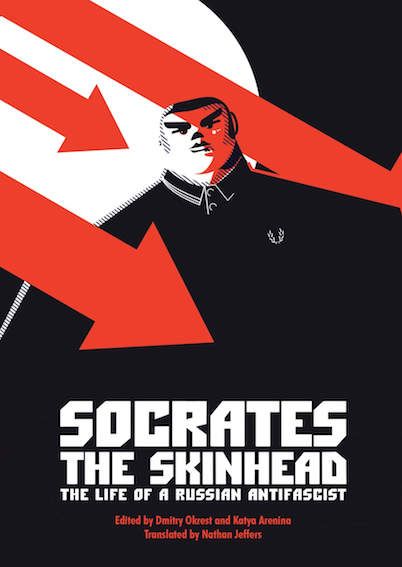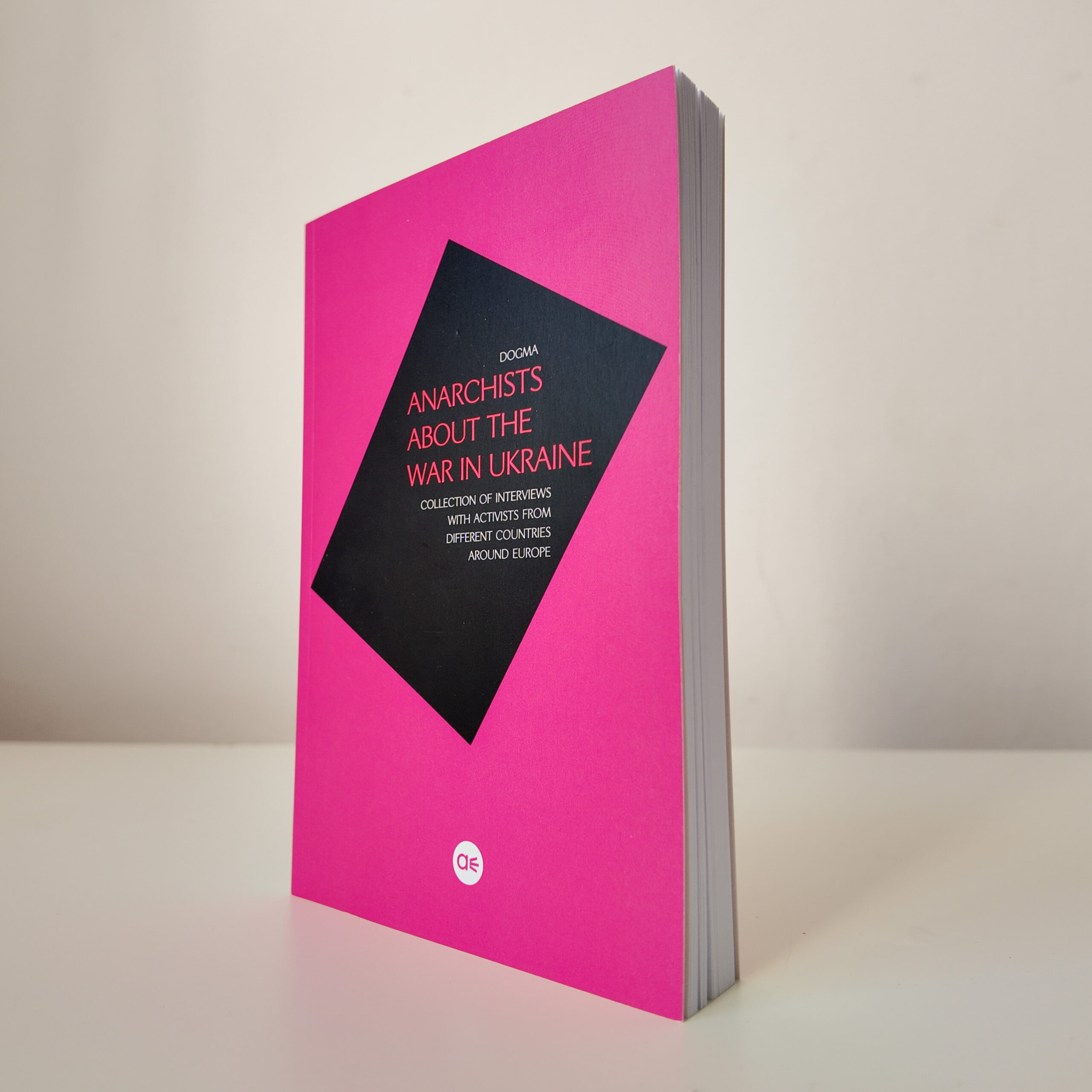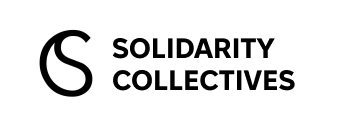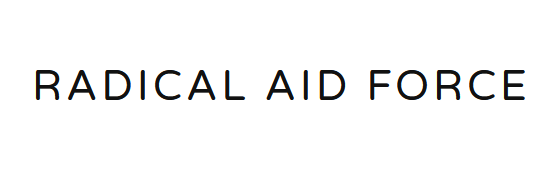© Hannah Uhlmann
Bücherkiste
Anarchismus in Russland
Valerie Brosch ist Autorin des Interview-Sammelbands Gegen die russische Staatsgewalt. Berichte von anarchistischem Widerstand und alternativlose Solidarität – erschienen beim Unrast Verlag.
Interview mit Valerie Brosch
August 2025
>>
Die Grundlage des Sammelbands von Valerie Brosch wurde während ihres Masterstudiums an der FU Berlin gelegt, wo sie Europastudien mit soziologischem Schwerpunkt studierte. In ihrer Abschlussarbeit beschäftigte sie sich mit sozialen Bewegungen unter repressiven Bedingungen, am Beispiel anarchistischer Organisierung in Russland. Die zentrale Frage: Wie ist überhaupt Widerstand möglich in einem System, das gezielt auf Kontrolle, Einschüchterung und Gewalt setzt? Und warum gelingt es gerade horizontal organisierten Gruppen immer wieder, handlungsfähig zu bleiben?
Den konkreten Anstoß gab der 24. Februar 2022, der Beginn der russischen Vollinvasion der Ukraine. Brosch erlebte, wie in Teilen der deutschen und europäischen Linken Russland nicht klar als Aggressor benannt wurde. Stattdessen dominierte oft die Erzählung vom NATO-Stellvertreterkrieg. Diese Relativierungen wirkten falsch, politisch wie analytisch. Gleichzeitig tauchten immer mehr Meldungen auf über Anschläge auf Rekrutierungsbüros in Russland, Sabotageakte, Protestaktionen – alles unter härtesten Bedingungen.
Aus dieser Auseinandersetzung entstand ein Buch, das sich nicht wissenschaftlich, sondern journalistisch nähert. Es hört zu, dokumentiert und gibt Stimmen aus dem anarchistischen Widerstand Raum.
Im folgenden Interview geht es um die Gefahren, denen widerständige Bewegungen in Russland ausgesetzt sind, um die Frage, wie sie überhaupt entstehen konnten, welche historischen Bedingungen sie geprägt haben und welche Rolle Literatur in ihrer Entwicklung spielt.
Ostjournal: Wie würdest du die Entwicklung des russischen Anarchismus im Kontext der aktuellen politischen Situation einordnen?
Valerie Brosch: Was ich am russischen Anarchismus besonders spannend finde, sind seine historischen Ursprünge. Die Bewegung reicht bis ins Zarenreich zurück, genauer gesagt in die Übergangszeit vom 19. zum 20. Jahrhundert. Damals fand eine sehr rasante Industrialisierung statt, parallel zu Prozessen der nationalstaatlichen Konstituierung. Das russische Imperium – ein durch Kolonialisierung gewachsenes Vielvölkerreich – versuchte zunehmend, seine Macht zu zentralisieren und die Peripherien stärker an das Machtzentrum zu binden. Das betraf vor allem Regionen, die heute zur Ukraine, zu Russland, Polen oder Armenien gehören.
In diesen Regionen entstanden große wirtschaftliche Spannungen durch die Industrialisierung, aber auch politische und soziale Konflikte. Es gab eine starke Russifizierung – zum Beispiel in Georgien, wo die georgisch-orthodoxe Kirche durch die russisch-orthodoxe verdrängt wurde.
In diesem Kontext hat sich die anarchistische Bewegung zum ersten Mal wirklich als politische Kraft organisiert. Und ich finde es wichtig, diesen Hintergrund mitzudenken – gerade aus einer dekolonialen Perspektive. Denn die Wurzeln des russischen Anarchismus liegen eben nicht nur im heutigen Russland, sondern auch in Gebieten wie der Ukraine, Georgien, Armenien oder Sibirien.
Spannend ist auch, wie sich die Bewegung durch die verschiedenen Umbrüche der russischen Geschichte hindurch immer wieder neu formiert hat. Anarchist*innen spielten eine Rolle während der Revolution 1905, dann erneut 1917 – und es gab auch in der frühen Sowjetunion Versuche, anarchistische Ideen weiterzutragen. Spätestens unter Stalin wurde die Bewegung dann vollständig unterdrückt, viele mussten ins Exil.
Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat sich der Anarchismus erneut reorganisiert. Es entstanden neue Gruppen, die vor allem während der neoliberalen Umstrukturierungen in den 1990er-Jahren aktiv wurden – etwa in Form von Arbeiterprotesten und Streiks. Diese Linie zieht sich bis heute weiter. Ich könnte stundenlang darüber sprechen, weil ich finde, dass diese Perspektive viel zu selten wahrgenommen wird – obwohl sie zweifellos existiert und wichtige Beiträge zu sozialen Kämpfen geleistet hat.
Ostjournal: Du gehst ja auch auf die Straßenkämpfe der Nullerjahre ein – eine Zeit, in der es zu heftigen Auseinandersetzungen mit russischen Neonazis kam. Dabei wird heute oft gewarnt, dass nach einem möglichen Ende der Putin-Ära rechtsextreme Kräfte in Russland die Macht übernehmen könnten. Was hältst du von solchen Einschätzungen?
Valerie Brosch: Wie du ja schon angesprochen hast, zeigen die Entwicklungen in den Nullerjahren deutlich, dass es bereits damals Verbindungen zwischen rechtsextremen Gruppen und Kreml-nahen Kreisen gab. Die Morde und Angriffe, die in dieser Zeit verübt wurden, geschahen zwar nicht immer im direkten Auftrag des Staates – aber vieles deutet darauf hin, dass sie zumindest geduldet oder politisch in Kauf genommen wurden. Teilweise gab es sogar Hinweise auf direkte Verbindungen oder eine stille Billigung durch staatliche Akteure.
Was heute passiert, ist meiner Meinung nach noch viel klarer: Die Politik, die Putin derzeit betreibt, ist de facto rechtsextrem. Insofern ist die Vorstellung, dass es erst nach seinem Abgang zu einer Machtübernahme der extremen Rechten kommen könnte, etwas irreführend – denn wir erleben diese Politik bereits jetzt.
Man muss sich nur anschauen, wie massiv queeres Leben bedroht wird, wie stark Rassismus und Ausländerfeindlichkeit verbreitet sind, oder wie migrantische Arbeitskräfte – etwa aus Zentralasien oder Sibirien – systematisch ausgebeutet und diskriminiert werden.
Dazu kommt ein ideologisches Gerüst, das von einer großrussischen Nationalidee bis hin zu imperialen Fantasien eines eurasischen Reiches reicht. Diese Ideen knüpfen direkt an das Denken extrem rechter Theoretiker wie Alexander Dugin an, die ganz offen Einfluss auf die ideologische Ausrichtung des Staates nehmen.
Außerdem ist nicht zu übersehen, wie aktiv Russland rechtsextreme Akteure und Parteien auch außerhalb seiner Grenzen unterstützt – sei es durch direkte Vernetzung, durch Wahlbeeinflussung oder über Desinformationskampagnen. In vielen europäischen Ländern lassen sich Verbindungen nachweisen zwischen russischen Institutionen und dem Erstarken rechtsextremer Bewegungen.
Was passieren würde, wenn Putin nicht mehr an der Macht ist, bleibt natürlich Spekulation. Es gibt verschiedene Szenarien – von einem Machtvakuum bis hin zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Dabei würde vermutlich ein harter Machtkampf unter den verschiedenen Geheimdiensten entstehen, die in Russland traditionell großen Einfluss haben und untereinander konkurrieren. Sicher ist: Ein demokratischer Aufbruch scheint unter den gegenwärtigen Bedingungen eher unwahrscheinlich.
Ostjournal: Also würdest du nicht die These unterstützen, dass Putin eine Art Brandmauer für Russland sei?
Valerie Brosch: Das System, das er geschaffen hat, und die Politik, die aktuell betrieben wird, bieten keinerlei Schutz vor rechter Gewalt oder autoritärer Eskalation. Die Menschen sind jetzt schon massiv bedroht. Man muss sich nur anschauen, wie viele Oppositionelle im Gefängnis sitzen – oft mit extrem hohen Haftstrafen. Es gibt zahlreiche Berichte über Folter, Einschüchterung und unmenschliche Haftbedingungen.
Dazu kommen immer neue Gesetze, die in ihrer Radikalität kaum zu fassen sind: Die Einstufung der LGBT-Bewegung als extremistisch ist nur ein Beispiel. Inzwischen steht sogar die Body-Positivity-Bewegung zur Debatte – es nimmt absurde und gleichzeitig gefährliche Ausmaße an.
Insofern: Nein, Putin ist keine Brandmauer gegen den Rechtsextremismus. Er ist vielmehr Teil eines Systems, das diesen autoritären und reaktionären Kurs vorantreibt.
Ostjournal: Gab es Momente in denen du ein bestimmtes Sicherheitsrisiko für die von dir interviewten Gruppen bzw. Einzelpersonen befürchtet hast?
Valerie Brosch: Natürlich gab es auch Sicherheitsbedenken – von den Interviewpartner:innen, aber auch von meiner Seite. Ich habe im Vorfeld lange überlegt, wie ich die Kommunikation möglichst sicher gestalten kann. Die Interviews fanden auf den jeweils bevorzugten Wegen statt: manche schriftlich, manche per Video-Call oder auch analog im direkten Gespräch. Mit Personen, die sich im Exil befinden, war es natürlich einfacher. Insgesamt hatte ich den Eindruck, dass viele einfach froh waren, dass sich überhaupt jemand aus Deutschland ernsthaft für ihre Perspektiven interessiert. Das war oft ein großer Antrieb, trotz aller Risiken ins Gespräch zu kommen.
Ostjournal: Die anarchistische Bewegung in Russland hat ja in den letzten Jahren mehr Erwähnung und Anschluss bekommen. Was genau, glaubst du, fasziniert die Menschen besonders daran?
Valerie Brosch: Ich glaube, ein wichtiger Grund ist zunächst einmal, dass dieser Widerstand überhaupt existiert – und das in einem Staat wie Russland, der extrem repressiv ist. Allein die Tatsache, dass Menschen sich dort unter diesen Bedingungen organisieren und aktiv werden, ist schon ein starkes Zeichen. Was diesen Protest besonders macht, ist, dass er eben nicht aus dem bürgerlich-liberalen Spektrum kommt – wie etwa bei Alexej Nawalny oder mittlerweile auch Julija Nawalnaja. Es geht hier nicht um Opposition aus oligarchischen oder parteipolitischen Kreisen, sondern um Widerstand von unten.
Ein weiterer Aspekt, der, glaube ich, viele interessiert, ist die Frage, wie anarchistische Organisation unter den Bedingungen eines autoritären Staates überhaupt funktioniert. Und gerade diese horizontale, dezentrale Struktur macht die Bewegung ja auch anpassungsfähig – flexibel im Handeln und gleichzeitig in der Lage, immer wieder Räume der Solidarität zu schaffen.
Es geht dabei nicht um Macht oder darum, die nächste Regierungspartei zu stellen. Es geht um konkrete Handlungen, um unmittelbares Eingreifen. Das macht es auch für viele attraktiv, weil es nicht um die große Frage geht: Wer könnte Putin ablösen? Oder: Wie sähe ein neuer Staat aus? Sondern es geht um praktische Selbstorganisierung, um Widerstand im Alltag – jenseits staatlicher Machtlogik. Und genau das berührt viele Menschen.
Ostjournal: In deinem Buch beschreibst du, dass viele der Personen, die du interviewt hast, über Literatur zum Anarchismus oder zu widerständigen Bewegungen politisiert wurden. Wenn man sich selbst intensiver mit dem Thema befassen möchte – kannst du Literatur empfehlen, die einen guten Einstieg bietet? Abgesehen von deinem eigenen Buch natürlich.
Valerie Brosch: Tatsächlich gibt es zu genau diesem Thema – also zur aktuellen anarchistischen Bewegung in Russland – nur sehr wenig Literatur, vor allem im deutschsprachigen Raum. Das ist mir schon bei der Recherche für meine Masterarbeit aufgefallen. Es gibt da eine große Lücke.
Oft wird der russische Anarchismus eher aus einer historischen Perspektive betrachtet oder anarchistische Akteure werden nur am Rande erwähnt – als Randfiguren oder Subkulturen. Eine aktuelle, differenzierte Auseinandersetzung fehlt in vielen Fällen, auch im englischsprachigen Raum.
Aber es gibt ein paar sehr gute Ausnahmen, die ich empfehlen kann:
„Spezialoperation und Frieden“ – von Ewgeniy Kasakow
Das ist ein Sammelband, der sich mit linken Positionen zum Krieg in der Ukraine befasst. Es geht darin um ganz unterschiedliche Perspektiven aus dem linken Spektrum – teils zustimmend, teils ablehnend oder ambivalent. Mittlerweile ist auch eine zweite, erweiterte Auflage erschienen. Ich finde das Buch sehr spannend, weil es verschiedene Stimmen zu Wort kommen lässt und ein differenziertes Bild zeichnet.
„Socrates the Skinhead: The Life of a Russian Antifascist“
Dieses Buch beschäftigt sich mit Alexei Sutuga, einem bekannten russischen Anarchisten, der in den 2000er-Jahren stark im antifaschistischen Kampf und in Umweltprotesten aktiv war. Das Buch ist eine Mischung aus Erinnerungen von Genoss:innen, Interviews und Zeitungsartikeln. Es gibt einen sehr lebendigen Einblick in die anarchistische Bewegung der 2000er- und 2010er-Jahre.
„Anarchists About the War in Ukraine“ – herausgegeben von Dogma Anarchist Collective
Das ist ein kleines, aber sehr inhaltsreiches Buch, in dem Interviews mit Anarchist:innen aus Belarus, der Ukraine, Russland, Deutschland und Finnland veröffentlicht sind. Es zeigt eine große Bandbreite an Positionen und liefert Einblicke in die konkreten Erfahrungen und Einschätzungen der Beteiligten. Auch das kann ich sehr empfehlen.
Valerie Brosch: Das sind drei sehr unterschiedliche Zugänge – ein theoretischer Sammelband, eine Interviewreihe mit aktuellen Stimmen und ein biografischer Rückblick – und zusammen vermitteln sie ein ziemlich gutes Bild davon, was anarchistischer Widerstand im postsowjetischen Raum bedeutet.
Ostjournal: Wie können wir von hier aus Solidarität mit denGruppen zeigen? Welche Möglichkeiten gibt es, sie konkret zu unterstützen?
Valerie Brosch: Ja, das geht auf jeden Fall. Ein erster wichtiger Schritt ist, ihre Positionen und Berichte zu lesen und zu verfolgen – viele schreiben auch auf Englisch. Es ist wichtig, die Perspektive dieser Menschen in die eigene Meinungsbildung einzubeziehen und den Krieg nicht nur aus einer westlichen Sicht zu betrachten. Diese Perspektiven bleiben oft unterbelichtet.
Darüber hinaus gibt es konkrete Gruppen und Fälle, die direkt Unterstützung benötigen und bei denen man helfen kann. Viele dieser Gruppen sind über Instagram oder Telegram erreichbar, oft auf Russisch. Mit etwas Aufwand lassen sich die Inhalte übersetzen. Es ist wichtig, diesen Perspektiven zu folgen und sie nicht zu ignorieren.
<<
Wer die Aktivitäten anarchistischer Gruppen weiter verfolgen möchte, hier findet sich eine kleine Auswahl:
Solidarity Zone
Eine von Anarchist:innen gegründete Gruppe, die politische Gefangene unterstützt, die wegen ihrer Antikriegsaktionen von Repression bedroht sind.
Solidarity Collectives
Ein großes Netzwerk in der Ukraine, das auch russische Anarchist:innen unterstützt, die auf der russischen Seite an der Front kämpfen.
Radical Aid Force
Eine Gruppe aus Deutschland, die Geld sammelt, Transporte in die Ukraine organisiert und sowohl Menschen an der Front als auch verletzliche Gruppen hinter der Frontlinie unterstützt.
ABC Belarus
ABC leistet wichtige Solidaritätsarbeit mit Anarchist:innen in Belarus, die gegen russische Staatsgewalt und Einfluss kämpfen. Sie freuen sich ebenfalls über Spenden und haben schicken Merch.
Valerie Brosch hat Sozialwissenschaft und Osteuropastudien in Bochum und Berlin studiert. Sie beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit der Geschichte und Gesellschaft Russlands und mit emanzipatorischen Bewegungen in verschiedenen osteuropäischen Ländern.