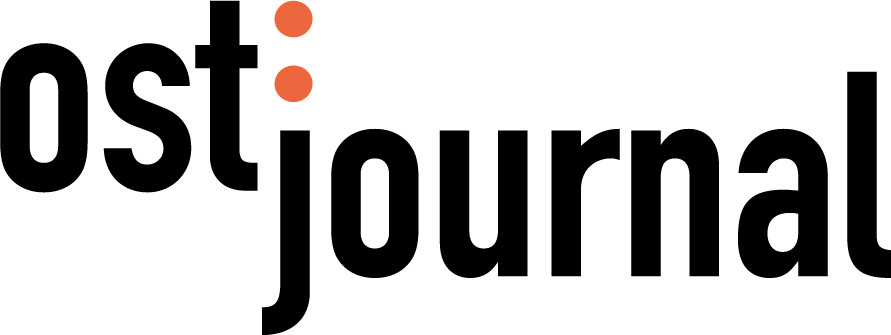© Hannah Uhlmann
Nackt über Berlin
Außer Atem – zwischen Luxusapartment, Dong-Xuan und Neubauwohnung
Die ARD-Miniserie „Nackt über Berlin“ ist weit mehr als ein Jugenddrama. In sechs Teilen erzählt sie mit Tempo, Witz und Tiefgang von zwei Ostberliner Teenagern, die ihren Schuldirektor entführen – auf der Suche nach Wahrheit, Gerechtigkeit und sich selbst. Dabei verwebt Ranisch Themen wie Mobbing, Rassismus, queeres Begehren und soziale Herkunft zu einem vielstimmigen Panorama heutiger ostdeutscher Lebensrealität. Digitale Kommunikation, migrantische Perspektiven und familiäre Traumata verschränken sich mit der Frage nach Schuld und Verantwortung. Was als krimineller Streich beginnt, wird zur emotionalen Aufarbeitung – und zu einer leisen Liebesgeschichte.
von Angelika Nguyen
August 2025
>>
Der Titel der 6-teiligen Miniserie „Nackt über Berlin“ ist irreführend. Eigentlich müsste er heißen „Nackt über Ostberlin“. Stringent, bis auf zwei Familienbesuche, bleibt Autor und Regisseur Axel Ranisch mit seinen Figuren im Osten der Hauptstadt, erzählt, wie die Leute dort ticken, aus dem Blick von drei Generationen. Dazu gesellt sich als Resultat ehemals sozialistischer Solidaritätspolitik eine migrantische Perspektive aus dem Fernen Osten, also von Eingewanderten aus Vietnam in die DDR und ihren Nachgeborenen. Das führt zu einem höchst bunten Figurenensemble mit vielen dramatischen Geschichten. Hauptplot ist eine Entführung. Sie setzt die beiden jugendlichen Kidnapper unter hohen Stress. Für sie gilt es, die Wahrheit über einen bereits als abgeschlossen geltenden Vorfall in ihrer Schule zu erfahren.
Die Serie ist ein Rachedrama, spannend und sexy, tragisch und witzig, derb und sensitiv zugleich. In Bewegung bleiben ist das Überlebensmotto der Beteiligten, hohes Tempo bestimmt die Erzählung.
Rasant unterwegs
Eben noch Lichtenberg-like in einer Neubauwohnung, Typ 21-Geschosser, dann Abstecher zum Dong-Xuan-Center Herzbergstraße, wieder auf die Frankfurter, weiter geradeaus die Karl-Marx-Allee entlang radeln bis nach Mitte, zum Ziel: die schon zu DDR-Zeiten schicke Leipziger Straße, U-Bahn-Station Spittelmarkt, wo jetzt erst recht die Luxuswohnungen blühen. Diesen Weg radeln oder laufen zwei 16jährige Teenager, die beiden Hauptfiguren Jannik und Tai, in der Serie oft hin und her, in rasanter, rebellischer und auch krimineller Mission.
Jannik und Tai verbindet ein gemeinsames Los. Beide werden sie mit verbaler und körperlicher Gewalt in der Schule gemobbt. Jannik, weil er als „zu dick“ gilt und Tai, weil er aus einer vietnamesischen Familie stammt. Beide fallen auf, weil sie nicht der „Norm“ entsprechen. Das stattet sie mit einem besonderen Blick aus für alles, was in ihrer Umgebung passiert.
Gleich zu Serienbeginn entführen die beiden ihren Lehrer und Schuldirektor Lamprecht, den Tai zufällig eines Nachts irgendwo in Mitte sturzbetrunken auf einer Parkbank vorfindet. Er schreibt Jannik, der im Neubauzimmer schon im Bett liegt. Schnell ist Jannik auf dem Fahrrad und fährt die Route runter Richtung Mitte, zur Parkbank. Sie bringen Lamprecht in seine eigene Wohnung im oberen Stockwerk eines Luxusgebäudes am Spittelmarkt, setzen ihn hermetisch gefangen, quälen ihn mehrere Tage mit Wasser-, Kontakt- und Lebensmittelentzug. Tai und Jannik wollen ihn zum Reden bringen und die ungeklärten Umstände des Selbstmords ihrer Mitschülerin Melanie aufklären.
Gen Z
Anstifter der Entführung ist Tai, Jannik läuft erst mal nur mit, spaßeshalber. Bald stellt sich heraus, das ist kein Spaß. Zunächst versteht man weder den Grund für die Entführung noch, was Tai antreibt. Und erst allmählich versteht man, warum Jannik da mitmacht, er ist in Tai verliebt und mag dessen Beweglichkeit, seine Art, ihn, Jannik, herauszuholen aus seinem Bett, seinem Zimmer, seinen Tschaikowski-Träumen, in eine neue Wirklichkeit. Erwachte Sexualität, Lebensklugheit, rasche Nachrichten hin und her, Musik, Videos – das sind die Energiequellen der beiden, die fortan hin und her hetzen zwischen Schulalltag, Familien, Observation – und Talk mit dem Gefangenen mittels eines Avatars über Lamprechts Laptop. Als Angehörige der Generation Z, der Digital Natives und als Erste, die ihre gesamte Sozialisation mit digitalen Geräten durchlaufen haben, sind Tai und Jannik in der Lage, die High-Tech-Wohnung des Lehrers funktionell lahmzulegen. Sie können aus der Ferne Strom, Wasser, Schließanlage ausschalten. Den Router haben sie vor Ort zerstört. Damit haben sie Lamprecht von der Umwelt abgeschnitten. Auf dieser Besonderheit der nach 2000 Geborenen ist die Idee der Serie aufgebaut. Digitale Kommunikation und Information ist ständiger Teil ihres Alltags. Die Erzählung läuft daher oft über Screen-Splitting: wir sehen die Handlung in parallelen Szenen. Da Jannik irgendwann Tais Passwort für die Cloud errät, kann er sich ins Archiv des ständig filmenden Tais einloggen.Das führt dann zu Doppelszenen wie dieser: Jannik sitzt scheinbar untätig herum und entdeckt indessen hochdramatisch in seinem Smartphone den Schlüssel zur Aufklärung um Melanies Tod. Äußere Bewegungslosigkeit und innere hyperaktive Bewegtheit zugleich, so zeigen die Szenen eindrücklich, sind wohl ein weiteres Merkmal der Gen Z.
Aufklärung
Die Serie deckt auf, wie Lamprecht, das Opfer von Entführung, Folter und Freiheitsentzug durch Jannik und Tai zuvor selbst Täter war.
Die Mitschuld des Lehrers am Tod von Melanie wird allmählich erzählt, auch seine ignorante Art, die Schule zu beherrschen. Zudem ist er als Teil des Wohlstandsbürgertums arrogant gegenüber Eltern, die er sozial unter sich wähnt. Das legt die Serie am Ende vollständig bloß, das können Tai und Jannik erkennen und mehr noch: sie bringen den Lehrer zu einem Geständnis. Der Blick auf die eigene Schuld ist das, was Lamprecht noch gut tun wird.Aber er war nicht der Einzige aus dem Lehrkörper, der Schuld trägt. Die Umstände des Selbstmords der Schülerin Melanie, die in ihre Deutschlehrerin Gieseking verliebt war und öffentlich dazu stand, weisen wiederum auf Gieseking selbst als Verursacherin der Krise des Mädchens. Gefährdet waren die heile Norm-Welt, der Ruf der Schule und nicht zuletzt Karrieren.
Aber die Dramaserie geht weit über diese zentrale Geschichte hinaus, sie geht in die Familien, führt an Kaffeetische und in Konflikte, in eine Küche im Dong-Xuan-Center, dem Großhandelszentrum vietnamesischer Communitys, wo Tais Oma arbeitet, erzählt tiefsitzende Traumata, manchmal witzig wie bei Janniks Verwandten an der Nordsee, manchmal unheilbar wie beim hinterbliebenen Vater von Melanie, manchmal reparabel wie die Entfremdung zwischen Lamprecht und seinem Sohn.
Tais Trauma
Als Schlussakkord hebt der Regisseur sich eine entscheidende Geschichte aus Tais Kindheit auf und gibt ihr damit besonderes Gewicht. Tai erzählt sie in einem Brief auf echtem Papier an Jannik in der letzten Folge. Als Kind vietnamesischer Eltern und Enkel einer Vertragsarbeiterin kennt Tai seit frühester Kindheit Rassismus. Sein größtes Trauma erlebte er als etwa Sechsjähriger auf einer Straßenbahnfahrt mit dem Vater, ein Überfall von Nazi-Glatzköpfen, die wie aus den 90ern hergeholt wirken. Sie verletzten – in Gegenwart untätiger anderer Fahrgäste – den Vater schwer, seither kann Tais Vater kaum noch sprechen. Beinahe noch schlimmer vielleicht war es für das Kind, die nachfolgende Ohnmacht seiner Eltern auf der Polizeiwache zu erleben, wo ein Beamter ungerührt die Anzeige abweist mit dem Hinweis, es könne genauso gut eine „Fehde unter Landleuten“ sein. Ein Argument, das sich auch schon Opfer der rechten Gewalt in den 90ern und in den 2000ern nach NSU-Morden anhören mussten. Tais Vater brachte dem Sohn seither bei, lieber zu schweigen, sich nicht anzulegen, „höflich“ zu sein.
Tai filmt andauernd mit dem Smartphone, es ist, als wolle er so viel wie möglich einfangen, dokumentieren, er ist auf Achse, ist ständig in Bewegung. So erwischt er am Ende auch die Beweise für den wahren Hergang von Melanies Tod. Eine gewisse Härte ging von Tai seit Beginn der Serie aus, eine Art Kälte. Aber das täuschte. Er habe, so schreibt Tai an Jannik weiter, aus dieser seiner Geschichte heraus ein zärtliches Gefühl für alle, die anders sind. Besonders für Jannik. So stellt sich am Ende das Buddy-Movie als queere Liebesgeschichte heraus.
Zärtlichkeit für alle Außenstehenden – das kann man auch als Credo des Autors und Regisseurs Ranisch lesen. Axel Ranisch, der offen queere Ausnahmeregisseur, 1983 geboren in Lichtenberg, erzählt hier einmal mehr filmisch einfallsreich und dramaturgisch sicher. Er weiß den Schauspielenden, die er liebt, das Maximale an Leistung zu entlocken. Allen voran Lorenzo Germeno als Jannik, Anh Khoa Tran als Tai und Thorsten Merten als Lamprecht.In Bewegung sein, auf dem Sprung. Nur so finden die beiden Jugendlichen den Weg zu ihrer Emanzipation. Tai will nicht länger „höflicher Gast“ sein, Jannik sagt seinen Eltern, dass er schwul ist, und sogar Lehrer Lamprecht, der alte Boomer, hat am Ende noch etwas davon. Denn auch er, statt Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten, bricht nochmal neu auf.
Typisch Ranisch und ganz selbstverständlich und ohne als „Thema“ daherzukommen, ist in der Serie Diversität – die Figuren sind queer und hetero und People of Color und Schwarz und Weiß und aus verschiedenen Klassen und migrantisch und ostdeutsch und genderfluid und dick und dünn.
Bewegte Bilder über sich bewegende Menschen in ständig sich ändernden Lebenslagen. Mitten in Ostberlin.
„Nackt über Berlin“, TV-Miniserie, Regie: Axel Ranisch, 2023
Abrufbar in der ARD-Mediathek bis 6. Oktober 2025
<<
Angelika Nguyen wuchs in der DDR, Ostberlin auf. Sie studierte Filmwissenschaften an der Filmhochschule Babelsberg, drehte 1991 den Dokumentarfilm „Bruderland ist abgebrannt“ über vietnamesische menschen in Ostberlin und ist tätig als Autorin und Filmjournalistin.