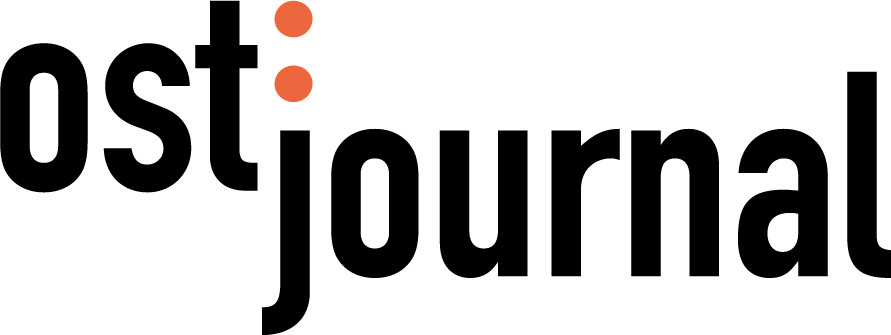© Hannah Uhlmann
Eine Geschichte
Insel ohne Umlaufbahn
Wie bewegt man sich durch eine Welt, die einem nie ganz gehört – und der man trotzdem nie ganz entkommt? In Insel ohne Umlaufbahn erzählt die Autorin Isza eindringlich und poetisch von Migration, Kindheit, sozialer Herkunft, Verantwortung und Identität. Es ist die Geschichte einer Familie, die sich auflöst, bevor sie wirklich ankommt – und eines Ichs, das versucht, in einem Dazwischen-Zuhause Fuß zu fassen. Mit großer sprachlicher Kraft und emotionaler Präzision wird sichtbar, wie Verletzlichkeit, soziale Mobilität und familiäre Unsichtbarkeit miteinander verwoben sind. Es geht um das Humpeln durchs Leben – nicht nur nach einem körperlichen Bruch, sondern auch entlang biografischer Bruchlinien.
von Isza
August 2025
>>
Ich bewege mich.
Schwerfällig und humpelnd. Nach einem Fußbruch, der nie richtig verheilt ist, bewege ich mich anders als zuvor: ängstlicher, verletzlicher und vorsichtiger, mit Gleichgewichtsstörungen. Vermeintlich. Denn ich habe mich auch schon vorher ängstlich, verletzlich, vorsichtig und wacklig bewegt – nur aus anderen Gründen.
Vorgärten aus Beton
Wenn ich über Bewegung nachdenke, denke ich an meine Mutter, die sich einst aus ihrem Herkunftsland nach Deutschland bewegte und uns damit als Familie in Gänze in Bewegung setzte. An meinen Vater, der ihr alternativlos folgte – wie ein Mond um einen Planeten. Wahrscheinlich war ihm damals schon klar, dass die Ehe nicht halten würde, und der Wechsel nach Deutschland sollte ihr noch einmal Aufschwung geben – oder war für ihn einfach wirtschaftlich attraktiv. Ich denke an meinen Bruder, der den Wechsel nicht wirklich wollte und als Erwachsener wieder zurückging. Ich denke daran, wie ich als Kind durch die Turnhalle tobte, die mittels aufgehängter Decken Räume und Privatsphäre simulieren sollte. Ich erinnere mich an andere spielende Kinder in den Notunterkünften, die ihre neue Umgebung erkundeten. Ich erinnere mich an viele Sprachen, die durch die Turnhalle waberten.
Später kamen wir in einem kleinen Familienzimmer in einer ausrangierten Schule unter. Unser Zuhause mit zwei Stockbetten, einem Schlafsofa, einem Tisch mit Stuhl und einem Kleiderschrank – und wir Kinder spielten auf den einstigen Schulhöfen, die nun unsere betonierten Vorgärten wurden. Nach über einem Jahr verschwand die Not vermeintlich und die Unterkunft begann. Wir zogen aus der Notunterkunft in eine Wohnung. Eine Wohnung mit richtigen Wänden, Räumen und einem Klingelschild, das unseren Nachnamen trug – in einem echten Bezirk mit Grünflächen. Wahrscheinlich haben sich meine Eltern schon damals darüber unterhalten, wie praktisch der Nachname meines Vaters ist – so deutsch, so unauffällig, so angepasst. Ein Nachname, der kaum gedankliche Bewegung beim Gegenüber auslöst, keine Reibung, weil er nicht aneckt und wirkt, als wäre er von hier und nicht von dort. Unsere Vornamen wurden eingedeutscht, unsere Identitäten auf das Deutsche eingestimmt, und wir setzten uns in Bewegung, um uns zu integrieren in die Unterkunft, die nie eine Ankunft sein sollte.
Zentimeter für Zentimeter Richtung Verantwortung
Ich erinnere mich, dass ich hier lernte, die ersten Wege allein zu gehen. Ich lernte die Wege zu meinen deutschen Freund*innen, zur Schule, über Schleichwege – und ich lernte, wie wertvoll Geld ist. Ich sollte schnell selbstständig werden und bekam zehn Mark, um in einem naheliegenden Laden ein paar Einkäufe für meine Mutter zu tätigen. Und ich ging los. Die Wege entlang, die ich schon zuvor mit meinem Bruder erkundet hatte. Konzentriert und stolz, dass ich nun Verantwortung bekam. Am Laden angekommen merkte ich, dass ich den Geldschein verloren hatte – und lief zurück. Mit jedem Meter Richtung zuhause weinte ich mehr, weil ich wusste, dass ich es meiner Mutter erklären musste. Am Klingelschild angekommen war ich völlig aufgelöst – und das erste Mal so richtig von mir enttäuscht. Ich verstand schon mit sechs Jahren, dass dieser Zehn-Mark-Schein ein kostspieliger Vertrauensvorschuss meiner Mutter war. Intuitiv verstand ich es. Ich verstand es, weil meine Eltern um vier Uhr früh Zeitungen zum Verteilen abholten, während ich auf dem Rücksitz döste. Ich verstand es, weil ich früher geweckt wurde, weil ich mitgenommen werden musste, wenn meine Mutter Kneipenklos und Universitätsbüros putzen musste und es nicht schaffte, mich vorher im Kindergarten abzugeben – oder wenn mein Bruder vor der Schule noch U-Bahnhöfe reinigen musste und mich nicht absetzen konnte. Ich verstand, dass es auch meine Verantwortung war, beizutragen – auch wenn ich es nur als Gefühl verstand.
Als Kind liebte ich es, über die Universitätsflure zu laufen, ohne zu verstehen, was Wissenschaft ist. Für mich war es eine andere Welt, riesengroß und grenzenlos. Sie war aufregend – voller leerer Flure, weiter Hallen und geschlossener Türen. Eine Welt, die mich träumen ließ, in der ich Freilauf hatte und die mir, ohne es damals zu merken, die Grenzen von Freiheit aufzeigte.
Zusammen mit meiner Mutter gingen wir den Weg zum Laden wieder ab – und wir fanden den Geldschein. Ich konnte meine Verpflichtung erfüllen. Ich fühlte mich nützlich.
Per Asphalt Richtung zuhause
Während jeder Sommerferien bewegten wir uns über die Grenze in Richtung Osten. Und mit jedem Jahr, das verging, bewegte ich mich ein Stück weiter weg von den Menschen, die dort – und nicht hier – lebten und die meine Familie waren. Meist war ich mit meinen Großeltern unterwegs, da meine Eltern arbeiten mussten. Ich erinnere mich an stundenlange Autofahrten über schier unendlich lange, zubetonierte Straßen. Ich erinnere mich an den Stillstand am Grenzübertritt und die folgenden Schlaglöcher, die sich in den ersten Jahren noch anfühlten wie Nach-Hause-Kommen. Ich verstand nicht, was Kilometerangaben sind, aber ich verstand, dass die Schlaglöcher nicht mehr lang bis zur Ankunft bedeuteten.
Ich erinnere mich an krächzende Radio-Maryja-Gebete aus den Autolautsprechern, an gekochte Eier und Wurststullen. Auch erinnere ich mich an den emotionalen Aufprall, als ich das erste Mal gefragt wurde, „woher ich kam“, da ich einen Akzent hatte, der markierte, dass ich nicht von hier, sondern von dort war. Und ich erinnere mich an die überschwängliche Freude darüber, dass ich noch Polnisch spreche, es aber nach Deutschland geschafft habe. Ich war verwirrt – und spätestens ab diesem Moment fremd in diesem Zuhause und angekommen im Dazwischen-Zuhause, in dem ich mich wie zwischen zwei Magnetpolen bewegte.
Zurück in Deutschland wusste ich oft nicht, was ich über meine Sommerferien berichten sollte – ich war ja nur zuhause und nicht in Italien, Spanien oder Frankreich. Ich ging nur auf Märkte, in Parks, in die Kirche und zum Spielen auf den Beton vor dem Haus. Ich sah nichts Neues, roch nichts Neues, lernte nichts Fremdes – nur noch mehr Zuhause, das halt etwas weiter weg war, aber zeitgleich auch an mehreren Orten. Ich lernte, wie das hiesige Bekannte das dortige Fremde war – und andersherum. Und dass beides zu mir gehörte. Aber das waren keine erzählenswerten Geschichten im Deutschunterricht.
Planet auf Abwegen
Meine Eltern trennten sich. Wir blieben für eine gewisse Zeit im Bezirk. Wir zogen um. Meine Eltern ließen sich scheiden. Erst später verstand ich, dass meine Mutter den Scheidungsantrag aussaß, um meinem Vater die Einbürgerung zu ermöglichen. Beeindruckend, wenn ich überlege, in welche Schwierigkeiten er uns ritt – Polizeieinsätze, Morddrohungen, Sicherheitsnummern und ein sprachliches Minenfeld: Was ich ihm und was ich ihr erzählen durfte. Wieder zwischen den Polen angekommen, war es ein sprachlicher und emotionaler Balanceakt, der an meinem Gleichgewicht zerrte. Ich wurde vorsichtig und ängstlich.
Dieses Ungleichgewicht manifestierte sich bei mir in starkem Drogen- und Alkoholkonsum. Ich klaute, was ich brauchte. Ich wusste, dass ich mittlerweile genügend sprachliches Kapital besaß, um mich rauszureden, akzentfrei unterm weißen Radar zu laufen, und jung genug war, nicht strafrechtlich interessant zu sein. Und ich wusste, dass ich meine Mutter nicht behelligen wollte, weil kein Geld da war und sie mit sich und der Integration in eine Realität beschäftigt war, in die sie uns unfreiwillig alle hineingezogen hatte. Am Ende hätte es nur mehr Übersetzungsarbeit für mich bedeutet – Hilfs- und Förderungsanträge auszufüllen, nur um etwas Geld übrig zu haben. Ich klaute Taschenrechner, Stifte und Geodreiecke für den Matheunterricht am Gymnasium, das ich natürlich besuchen musste; Schminke und Schmuck für mein Teenie-Ego. Ich klaute CDs aus Magazinen, um meine subkulturelle Identität zu speisen, ohne in diese finanziell investieren zu können – um mich abgrenzen zu können und ein neues Zuhause in einer anderen Gemeinschaft zu finden. Ich wurde „fremd“ gemacht – daher benahm ich mich auch fremd. Es war mir egal. Warum sollte ich mich integrieren, wenn ich früh verstand, dass das immense Kosten mit sich zog? Meine Eltern lebten es mir vor. Ihre Identitäten angepasst, ihre Wünsche eingenormt, ihre Meinung wegen des Akzents belächelt – und ihre Arbeit dankend unter Wert angenommen.
Toter Stern
Irgendwann bewegte ich mich im Sommer auch nicht mehr Richtung Osten. Ich wollte nicht mehr. Es wurde mir fremd. Ich machte es fremd, so wie ich es gelernt hatte. Ich wollte keine stundenlangen Autofahrten mehr, keine religiösen Tagesordnungspunkte, nicht mehr das Essen, die Musik, die Sprache. Ich bewegte mich dagegen. Was auch immer das dagegen war. Hauptsache weg. Es fiel zunächst nicht auf. Die Familiensprache wurde ohnehin nur zuhause gesprochen – und man war stolz, Deutsch zu sprechen, trotz Akzent, der immer die Grenze zwischen „die“ und „wir“ markierte. Das traditionelle Essen wurde nicht mehr gekocht, weil es zwischen Zeitungsaustragen, Putzen und Baustellenarbeit zu anstrengend war, und Fertigessen günstiger. Ich wurde zum Scheiblettenkind 1. Es passte mehr als Pierogi und Bigos. Und dass ich immer weiter weg ging, zu anderen Familien, die mein Zuhause wurden, war praktisch – weil meine Eltern wenigstens wussten, wo ich war. Ich ging zu fremden Familien, in fremde Galaxien, wurde dort aufgenommen und lernte Neues, lernte, was deutsch ist, und lernte, dass wir arm waren – monetär und sozial. Alle in meiner Herkunftsfamilie bewegten sich auf eigenen Umlaufbahnen, und das Aufeinandertreffen wurde immer seltener.
Unsere Familie ist implodiert, ohne ausreichend Energie für uns alle zu erzeugen. Wir zogen weiter. Ich wurde zur Schulabbrecherin und folgte dem meritokratischen Märchen: Dritter Bildungsweg, unbezahlte Praktika, Lehre, Lohnarbeit, Selbstständigkeit, akademischer Elfenbeinturm – und ich lernte noch mehr über Bewegung: soziale Mobilität, gläserne Decken und romantisierte Abwärtsmobilität jener, die mimetische Armut instrumentalisieren, und jener, die mimetischen Aufstieg leben, um anzukommen.
Już prawie cię nie widzę. Spróbuj odgadnąć kto jest kim 2
Ich wurde deutscher.
Sie blieben polnisch.
Ich bin nicht deutsch.
Und sie nicht mehr polnisch.
Mein Vater ist nicht der stereotype, dem Alkohol zugeneigte Bauarbeiter-Pole, sondern jener, der für seine Familie und sich Entwicklung wünschte und keinen Raum bekam, seine Sprachkompetenz zu entwickeln. Meine Mutter ist nicht die feministische Wunschvorstellung, die sich über politische Systeme hinweg für ein emanzipierteres Leben einsetzte. Mein Bruder ist nicht jenes perfekte Exemplum für gelungene Integration und ich bin nicht die Deutsche, die bedingungslos dankbar ist, hier zu sein und auch nicht jene, die weg gehen wird, weil das Dazwischen ihre Heimat ist und sie auch dazugehört.
Lange Zeit sah ich das Sprachliche als den alleinigen Auslöser unseres Auseinanderdriftens. Es waren solch langsame, kaum spürbare, mikroseismische Bewegungen, die die tektonischen familiären Platten verschoben. Was zunächst praktisch schien, führte zum Entzweien. Es formierten sich unterschiedliche familiäre Kontinente. Erst übersetzte ich als Kind Behördenbriefe in der Lingua Franca, der Sprache der Mehrheitsgesellschaft – und irgendwann sprach ich nicht mehr die Sprache meiner Mutter und hinterfragte Konzepte wie Muttersprache, Vaterland, Erstsprache und nationales Verständnis. Lange war ich wütend, warum sie mir ihre Sprache nicht beibrachten. Und irgendwann verstand ich, dass es auch gesellschaftlich nicht gewollt war – und meine Eltern das schnell verstanden hatten. Wir Kinder sollten uns unsichtbar integrieren.
Udawaj że mnie nie ma. Udawaj że zniknęłam 3
Heute denke ich, dass wir einfach das Pech einer dysfunktionalen Familie ohne sichtbaren Migrationsvordergrund hatten – eine Familie, die in ihrem Kern dahinschmolz. Unsichtbar in ihrer Einzigartigkeit – privilegiert, einfach unsichtbar werden zu können.
Geblieben ist das Gefühl, eine Insel zu sein – mit glazialen Rinnen und Gletscherschrammen. Deren Mehrheitssprache ein Mosaik aus Gefühls-, Denk- und Ausdruckssprache in vielen Sprachen ist. Deren Verletzlichkeit kaum zu greifen ist, weil sie nicht in Scherben liegt, nicht gekittet ist, sondern ein ganz neues Ganzes ist, das nicht auf bekannten Umlaufbahnen läuft. Deren Irrwege nicht berechenbar sind. Wenn ich traurig bin, höre ich Musik in meiner Gefühlssprache und wenn ich benenne, kritisiere und verändern will nutze ich ihre Sprache, um Brücken von Insel zu Insel zu bauen. Ihre Sprache, die meine ist.
Bewegen klingt für mich irgendwie euphemistisch. Für mich bedeutet es, in steter Unruhe und Getriebenheit zu sein, um endlich irgendwo anzukommen. Auf dem Weg dahin werden Stationen erkundet, belebt, befühlt, verstanden – und dann wieder verlassen, überwunden, vergessen. Ich lernte, mich dabei vorsichtig, ängstlich und verletzlich zu bewegen. Nicht zu meinem Schutz, sondern um die Anderen nicht zu irritieren.
Und so humple ich schwerfällig durch eine nicht-nationale Identität. Ich wähle, ob ich mich zeige oder ob ich mich in meiner weiß gelesenen Unterkunft verstecke, wenn ich emotional wieder nicht verstehe, dass wir sein dürfen und andere als nicht passend markiert werden. Während ich nicht zu jenen zu gehöre, die ernsthaft noch glauben, es gäbe ein homogenes Wir, das durch Herkunft markierungswert ist. Sondern ich gehöre zu jenen, die jetzt aufarbeiten was sie längst verdrängten und verstehen, ihre Markierung für Neues zu nutzen.
Niech nikt się nie porusza. Nikogo już nie słucham 4
<<
1 Müller, Eva (2022): Scheiblettenkind. [Graphic Novel]. Suhrkamp Verlag.
2 Songtext von Lor, Titel: Nikt, Übersetzung: „Ich kann dich fast nicht sehen. Versuche herauszufinden, wer wer ist.“, 2021
3 Songtext von Lor, Titel: Nikt, Übersetzung: „Tu so, als ob ich nicht da wäre. Tu so, als ob ich verschwunden wäre.“, 2021
4 Songtext von Lor, Titel: Nikt, Übersetzung: „Niemand soll sich bewegen. Ich höre auf niemanden mehr.“, 2021
Isza ist: Irgendwann eingewandert. Irgendwann im Schulsystem gescheitert. Irgendwann ausgebildet, studiert, angestellt, selbständig. Das akademische Game leveln. Lohnarbeit formte den Körper, Armut den neurospicy Geist. Irgendetwas mit Medien, Politik, strategischer Kommunikation und Linguistik. Analysieren von Radikalisierungsprozessen, kritisieren von anderem extremem Trash. Zwischen Punk, Wave und Techno sozialisiert. Manchmal demoralisiert, oft wütend, hin und wieder nett, immer Post-Ost. Kernkompetenz: Durchschnittlichkeit.