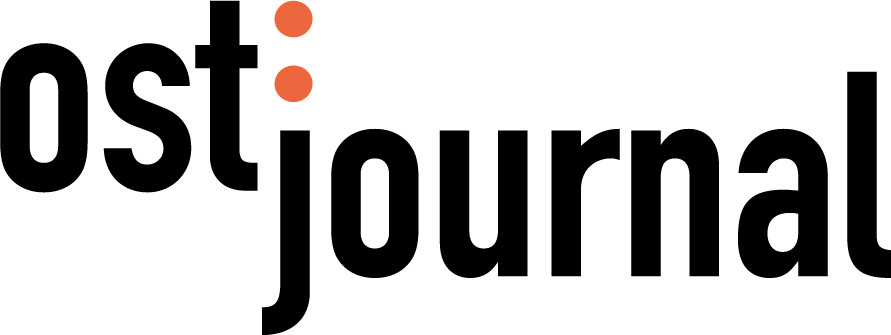© Hannah Uhlmann
Feminismus
Geht es voran oder fallen wir zurück?
Wie Frauenrechte in Kroatien unter Druck geraten
In Kroatien ist Abtreibung offiziell legal, doch in der Praxis erleben viele Frauen Stigmatisierung, Druck und institutionelle Probleme. Die Juristin und Aktivistin Nada Topić Peratović kämpft gegen einen konservativen Backlash und gegen das Schweigen der Gesellschaft.
von Konstantin Hadži-Vuković
August 2025
>>
„Jeden Tag werde ich in jeder Hinsicht besser“ flüstern die beiden 16-Jährigen mehrmals hintereinander, fast beschwörend. In Emir Kusturicas Debütfilm Erinnerst Du Dich an Dolly Bell? spielt sich diese Szene in einem Vorort von Sarajevo im Jahr 1963 ab. Dort wächst der junge Dino auf, streift durchs Jugendzentrum, entdeckt Kino und Musik und verliebt sich zum ersten Mal. Begeistert von Mystizismus, erprobt er sich in der Hypnose und findet aus einem Buch das Mantra, das für ihn zur zentralen Formel des Erwachsenwerdens wird. „Jeden Tag werde ich in jeder Hinsicht besser.“ Doch wie steht es um Gesellschaften? Werden auch sie, wie mancher Teenager über sich selbst hofft, „jeden Tag in jeder Hinsicht besser“? Oder verlieren sie – wie Kroatien beim Thema Abtreibung– längst errungene Rechte wieder?
„Die kroatische Gesellschaft entwickelt sich rückwärts. Sie rutscht definitiv zurück“, sagt Nada Topić Peratović. Die feministische Aktivistin gründete 2011 die Vereinigung Center for Civil Courage, später folgte Hrabre Sestre – „Mutige Schwestern“, eine Unterstützungsstruktur für Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch in Erwägung ziehen. Die Juristin ist im Hinblick auf die Situation deutlich: Seit Jahren überzieht eine neokonservative Welle das Land und die katholische Kirche hat das Terrain erobert. „Das Einzige, was daran tröstlich ist: Wir sind nicht das einzige Land, sondern ganz Europa ist betroffen.“ Es ist ein Backlash, der ehemals für garantiert gehaltene Rechte und Ideen rückgängig machen will. Frauen- und LGBTQ-Rechte geraten unter Druck. Positionen, die früher am Rand standen, sind heute salonfähig geworden.
Abtreibung in Kroatien: Legal, aber kaum zugänglich
Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Kroatien gesetzlich bis zur zehnten Woche nach der Empfängnis erlaubt. In Ausnahmefällen – etwa bei Gefahr für die Frau, bei Vergewaltigung oder schwerer Fehlbildung des Fötus – ist ein Abbruch auch nach der zehnten Woche möglich – mit Genehmigung einer ärztlichen Kommission. Im März 2017 bestätigte das kroatische Verfassungsgericht, dass das geltende Gesetz nicht gegen die Verfassung verstößt. Auf dem Papier scheint das Recht also gesichert.
Nada Topić Peratović bleibt dennoch skeptisch: „Wir haben gesehen, wie schnell sich in Polen oder den USA Gesetze kippen lassen oder Verfassungsgerichte ihre Meinung ändern.“
Die Aktivistin engagiert sich seit Jahren in der kroatischen Zivilgesellschaft und beobachtet genau, wie dieser konservative Kurs das Land verändert: Das Recht auf Abtreibung mag gesetzlich verankert sein – praktisch ist es jedoch zunehmend gefährdet. In ganz Kroatien gibt es laut einem Bericht von 2018 etwa 30 Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, davon 29 öffentliche Krankenhäuser und eine private Klinik. Laut dem Bericht verweigern etwa 59 Prozent der Gynäkologinnen und Gynäkologen dort den Eingriff. In manchen Städten ist der Anteil noch höher: In Split lehnten 2014 bis zu 95 Prozent der Ärztinnen und Ärzte Abbrüche ab, in Zagreb rund 66 Prozent.
Ermöglicht wird das durch das Recht auf Gewissensverweigerung. Das sei etwas, das ursprünglich für den Kriegsdienst gedacht war, sagt Nada. „Wie, wenn jemand nicht in den Krieg möchte, aus pazifistischen oder religiösen Gründen“. Genau das gibt es auch im kroatischen Arztwesen. Im Artikel 20 des Gesetzes über das Arztwesen heißt es, dass ein Arzt aufgrund seiner ethischen, religiösen oder moralischen Überzeugungen sich auf das Recht zur Gewissensverweigerung berufen kann und sich weigern darf, bestimmte Eingriffe durchzuführen. Das gilt, solange das Leben der Patientin nicht gefährdet wird. Auch verpflichtet der Artikel Ärzte dazu, Patientinnen und Patienten rechtzeitig zu informieren und an eine Kollegin oder einen Kollegen weiterzuverweisen. Die Realität sieht anders aus: Häufig überweisen Ärzte die Patientin nicht weiter. Zwei Krankenhäuser verweigern Abtreibungen sogar grundsätzlich und nutzen diese Gesetzeslücke gezielt aus. All das erschwere die tatsächliche Durchführung von den eigentlichen legalen Schwangerschaftsabbrüchen, erklärt Nada. Selbst die medizinischen Fakultäten hätten sich beim Thema Abtreibung seit Jahrzehnten in die Defensive zurückgezogen.
Einfluss der Kirche und moralischer Druck im Alltag
Ein zentraler Akteur, der da seine Hände im Spiel hat: die katholische Kirche. Sie verfolgt eine klare Agenda: das uneingeschränkte „Recht auf Leben“, das nicht verletzt werden darf. Mit ihrem Einfluss festigt und prägt sie in enger Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen die öffentliche Meinung gegen Abtreibung, erzählt Nada. Nach der Unabhängigkeit 1991 und dem darauffolgenden Krieg erlebten Nationalismus und katholische Kirche ein Revival in dem vormals sozialistischen Land. Alles, was als kommunistisch oder jugoslawisch galt, war „antikroatisch“ – so auch das in der kommunistischen Ära eingeführte liberale Abtreibungsgesetz. Seit den 1990ern nahm die Stigmatisierung von Abtreibung zu, sagt die Feministin. Die Folge: Frauen, die über einen Abbruch nachdenken oder einen solchen hinter sich haben, werden von der Gesellschaft ausgegrenzt. „Sie werden als Mörderinnen bezeichnet“, sagt sie. Vor allem in den Sozialen Medien treten verstärkt solche Stimmen auf, auch bekannte Persönlichkeiten schließen sich dem an. Obwohl Schwangerschaftsabbrüche rechtlich erlaubt sind, zögern deshalb viele Frauen, sich an offizielle Stellen zu wenden. Der gesellschaftliche Druck ist hoch – in der Familie, in Schulen, in Medien. Häufig erleben Frauen, die offen über eine durchgeführte Abtreibung reden, unangenehme Situationen, sagt Nada.
Und auch in den Kliniken selbst bleibt der Druck nicht aus. „Sind Sie sich denn auch ganz sicher, dass Sie abtreiben wollen?“, fragen manche Ärzte. Andere greifen zu emotionaler Manipulation – etwa, indem sie einer Frau in der sechsten Woche den Herzschlag des Embryos vorspielen. „Statt sich auf die Bedürfnisse ihrer Patientinnen einzulassen, urteilen viele auf verschiedenste Art und Weise über sie“, so Nada.
Der gesellschaftliche Wandel ist nicht nur auf institutioneller Ebene spürbar – auch auf Straßen und Plätzen zeigt sich der erstarkte Konservativismus. Seit 2016 finden jedes Jahr im Mai in mehreren Städten die sogenannten „Marches for Life“ statt: Demonstrationen der Lebensrechtsbewegung, die sich gegen Abtreibung und für „traditionelle“ Familienwerte einsetzen. Eine besonders auffällige Erscheinung sind die „Klecavci“– „die Knienden“, wie sie im Volksmund halb spöttisch genannt werden. Dabei handelt es sich um Männergruppen, die einmal im Monat auf zentralen Plätzen knien und beten – für eine männliche geistliche Führung in der Familie, gegen Abtreibung und gegen die sogenannte Gender-Ideologie.
„Sie beten dafür, dass Frauen sich wieder anständig kleiden und Ähnliches“, erzählt Nada. In Polen sei es nicht anders. „Eine Kollegin brachte es einmal gut auf den Punkt: Die bewegen sich sogar auf den Knien fort.“
Erst in den letzten Jahrzehnten tauchten diese Erscheinungen in Kroatien verstärkt auf. „Zu Zeiten Jugoslawiens gab es keine gesellschaftliche Ächtung von Abtreibungen“, sagt Nada. Erst mit dem Wiederaufstieg der Kirche in den frühen 1990er Jahren kam es zum plötzlichen Wandel. Abtreibung wurde zunehmend als moralisches Fehlverhalten dargestellt und zur größten Sünde in den Augen konservativer Politiker.
Jugoslawien – ein feministischer Vorzeigestaat?
Das heute in Kroatien gültige Gesetz zur Abtreibung stammt aus dem Jahr 1978 – einer Zeit, als das Land noch Teil des sozialistischen Jugoslawiens war. Im Unterschied zu vielen westlichen Ländern wie Deutschland, in denen Abtreibung weiterhin strafrechtlich geregelt ist, verfolgte Jugoslawien früh einen liberalen Ansatz. Bereits 1952 wurde Schwangerschaftsabbrüche unter bestimmten medizinischen, sozialen und ethischen Bedingungen erlaubt – zunächst jedoch nur nach Zustimmung spezieller Kommissionen. Für Nada war das ein enormer Fortschritt: Vor allem im Hinblick auf Deutschland oder Frankreich, wo die Frauen in den 1960ern und frühen 70ern für das Recht auf Abtreibung protestierten. Schaue man auf Frauen, wie Alice Schwarzer oder Simone de Beauvoir. „Wir hatten dieses Recht bereits und es war für uns etwas komplett Normales“. Trotz staatlicher Kontrolle und bürokratischer Hürden war die offizielle Politik eine gesellschaftliche Enttabuisierung und gesundheitliche Absicherung der Frau. 1969 fiel die Kommissionspflicht für die ersten zehn Schwangerschaftswochen. Mit dem Verfassungszusatz 1974 und dem Gesetz von 1978 wurde das Recht der Frau über eine Schwangerschaft zu entscheiden weitgehend garantiert. Das Gesetz blieb auch nach der Unabhängigkeit Kroatiens 1991 weitgehend unverändert in Kraft.
„Im Vergleich zu vielen westlichen Ländern war Jugoslawien sicherlich seiner Zeit voraus“, sagt die Feministin. Frauen erhielten bereits 1946 das Wahlrecht, während das in der Schweiz erst 1971 der Fall war. Die weibliche Emanzipation im ehemaligen Jugoslawien war ein erklärtes Programm. In den Fabriken standen Frauen an denselben Maschinen wie Männer, sie arbeiteten, organisierten, bauten mit auf. „Natürlich muss man auch hinzufügen, dass das ein Einparteiensystem war und keine Demokratie“, schiebt Nada nach. Heute, drei Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit, erscheint vieles davon anders. „Vielleicht haben die Menschen in Kroatien im Hinblick auf manche Sache tatsächlich einen Schritt zurück gemacht.“
Konformität und Schweigen – ein stiller Rückschritt
Was Nada beunruhigt, ist das Maß an stiller Anpassung, eine Konformität, die den Wandel begleitet hat. „Viele, die zu Zeiten Jugoslawiens, die größten Kommunisten, Marxisten und Atheisten waren, wurden dann in den 1990ern die lautesten kroatischen Nationalisten und Patrioten.“ Erinnerungen an Repressionen gehören inzwischen zum nationalen Narrativ. Man habe den Glauben nicht offen leben dürfen, heißt es oft. „Ich habe ganz normal Weihnachten gefeiert. Wir hatten sogar immer zwei Feiern, weil die eine Großmutter serbisch-orthodox und die andere katholische Kroatin war.“ Ihrer Erfahrung nach stellte das niemals ein Problem dar. Ein Witz bringt es für sie auf den Punkt: „Was unterscheidet einen kleinen, nur wenig patriotischen Kroaten, von einem großen, sehr patriotischen, Kroaten: Der eine wurde schon als Kind getauft, der andere erst mit dreißig, als es plötzlich nützlich war.“ Diese Form von Konformität beobachtet sie auch in der heutigen Ärzteschaft.
Eine Studie des kroatischen Zentrums für Bildung, Beratung und Forschung zeigt: Viele Mediziner vermeiden die Erbringung stigmatisierter Leistungen, aus Angst vor negativen Konsequenzen, wenn sie Abtreibungen durchführen, und um Diskriminierung und Stigmatisierung zu entgehen. „Das ist das Problem, diese Konformität, wo Menschen sich nicht trauen etwas zu sagen, weil sie sehen, dass das von der Mehrheit der Gesellschaft nicht gut aufgenommen wird“, sagt Nada. Sie trauen sich nicht, etwas zu sagen, und schweigen stattdessen. Gerade bei Ärztinnen und Ärzten sei das besonders enttäuschend. „Diese Frau, die vor dir sitzt, ist deine Patientin. Du bist verpflichtet, ihr zu helfen.“ Doch kaum jemand stelle sich offen gegen diese konservativen Stimmen. „Niemand wagt es laut zu sagen: Das sind unsere Patientinnen, keine Mörderinnen.“
Für Nada ist es genau das, was zu gesellschaftlichem Rückschritt führt: Menschen, die Angst haben, große Wellen zu schlagen oder Unruhe zu stiften. Es fehle an Mut. Deshalb sei der Aktivismus für sie das letzte Licht. Aktivismus entstehe aus Wut, sagt sie – aus dem Gefühl, nichts ändern zu können, obwohl eine offensichtliche Diskriminierung vorliegt. Es ist diese Wut darüber, wie Frauen von der Gesellschaft verurteilt werden, die sie antreibt. Immer mehr Frauen wenden sich in ihrer Not an die Tapferen Schwestern. Dafür braucht es Mut. Und vielleicht ist es genau dieser Mut, der etwas verändern kann.
<<
Konstantin Hadži-Vuković hat Politikwissenschaft und Philosophie in München und Rom studiert. Derzeit absolviert er seinen Master in Osteuropastudien in Berlin. Zum Journalismus kam er über den Hörfunksender M94.5, später arbeitete er als freier Autor für die Süddeutsche Zeitung. Heute schreibt er vor allem über Osteuropa und den Balkan u.a. für DIE ZEIT und den European Correspondent.